Johannes Calvin
(Quelle: Wikimedia)
Einige Regionen der deutschen Schweiz stehen im Ruf, dass ihre Bewohner ausgesprochen harte Schädel haben. Johannes Calvin war kein Schweizer, aber wenn es um das eigene Durchsetzungsvermögen geht, dann passt Calvin sehr gut in das Alpenland. Schliesslich wurde ihm mehr als einmal in seinem Leben Sturheit vorgeworfen. Geboren wurde der grosse Reformator 1509 in Noyon, einem kleinen Städtchen in der Picardie in Nordfrankreich. Schon in jungen Jahren entwickelte der kleinwüchsige Franzose die Fähigkeit, mit aller Entschlossenheit auf einem Standpunkt zu verharren – gegen allen Widerstand, ganz egal wie stark dieser auch sein mochte. Mit anderen Worten: Johannes Calvin war ein hochgebildeter Jurist und Theologe, der den Diskurs mit anderen Menschen schätzte und suchte. Sobald es aber um zentrale Lehren des christlichen Glaubens ging, konnte Calvin zum eifernden Dickschädel werden. Und dann konnte Calvin sogar grob werden, wie seine Zeitgenossen berichten. In seinem Hauptwerk, der Institutio, beschimpft Calvin seine Gegner mehrfach, wobei er bei der Wortwahl nicht wählerisch war.
Hartnäckig wie ein Holzscheit zeigt sich Calvin auch am zweiten Ostertag im Genf des Jahres 1538. Meinungsverschiedenheiten zu allerlei Kirchenfragen hatten bereits im Vorfeld zu Unstimmigkeiten zwischen ihm als dem ersten Stadtpfarrer und dem Rat von Genf geführt. Calvin weigerte sich nämlich, denjenigen Genfer Bürgern das Abendmahl auszuteilen, die es nach seiner Meinung nicht verdient hatten. Dummerweise befanden sich unter diesen Übervorteilten auch einige alteingesessene Enfants de Geneve, also Genfer Aristokraten. Und diese hatten keine Lust, sich ihren Lebenswandel von einem Pfarrer vorschreiben zu lassen. Erst recht nicht, wenn dieser auch noch Franzose war, also kein Genfer Bürger. So kam es in der Hitze der Auseinandersetzung wie es kommen musste. Als Calvin wegen des Abendmahlstreits das Predigen von Amtes wegen verboten wurde, strafte dieser im Gegenzug das Verdikt mit Nichtbeachtung und stieg am zweiten Ostermorgen mit grimmiger Entschlossenheit auf die Kanzel von St. Pierre. Von dort aus wetterte der sprachgewaltige Pfarrer gegen den Genfer Rat. Was seine Forderungen anbelangt, war Calvin dabei nicht bescheiden. Alle Genfer, die sich nicht auf ein von ihm – Calvin – verfasstes Glaubensbekenntnis vereidigen lassen wollten, hätten die Stadt zu verlassen. Zu Beginn gefiel den Räten diese Idee noch. Als sie aber erkennen mussten, dass bei der Umsetzung ein Exodus droht, konnten sie sich nicht mehr recht darüber freuen und machten einen Rückzieher. Nicht die Ketzer waren es, die gehen mussten. Calvin sollte entweder den Stadtherren gehorchen oder selbst Genf verlassen. Und dieser blieb einmal mehr hart: Calvin verliess die Rhonestadt schon am kommenden Morgen.
Das bis hierher erzählte scheint gut in das Bild zu passen, das viele Menschen von Johannes Calvin haben: Calvin der Eiferer, der anderen seine rigiden und strengen Moralvorstellungen aufzwängen will. Der Tyrann oder Despot gar, der es sich in den Kopf gesetzt hat, eine ganze Stadt in ein freudloses und enges Tugendkorsett zu pressen. Calvin, der Spielverderber.
Aber dieses Bild stimmt nicht. Gewiss, Calvin war ein Eiferer. Wer sich aber die Mühe macht herauszufinden, was den Reformator eigentlich antrieb, vor dessen Augen entsteht ein neues Bild von Calvin. Eines, das den grossen und oft als unnahbar empfundenen Genius als tief besorgten Mann zeigt. Besorgt um die Menschen. Denn Calvin hat beim Studieren der Bibel eine Entdeckung gemacht, die zum Mittelpunkt seines ganzen Lebens werden sollte. Aufgeschrieben hat er diese Entdeckung unter anderem in der Institutio Christianae Religionis (Unterricht in der christlichen Religion). Einem Werk, das in der Entwicklung des Protentantismus eine bedeutende Rolle spielte und bis heute nichts an Aktualität verloren hat.
Das gewichtige Buch
Institutio Christianae Religionis – Unterricht in der christlichen Religion
Wer Calvins Institutio lesen will, braucht Ausdauer und viel Zeit! Denn die deutsche Übersetzung der letzten Ausgabe aus dem Jahre 1559 umfasst 860 Seiten. Eng beschrieben in zwei Spalten mit kleiner Schrift. Während ihrer mehr als zwanzig Jahre dauernden Entwicklung ist die Institution zu einem umfassenden Kompendium herangewachsen, das alle Aspekte des christlichen Glaubens detailliert erläutert. Nach einer Einführung in die Gotteserkenntnis leitet das Werk über zu den Kernbegriffen des Christenglaubens: Gesetz und Sünde, Busse und Gebet, Vorsehung und Gnade. Zu den umfangreichsten Kapiteln gehört freilich dasjenige zum Gebet. Ferner die Erwählung und die Sakramente, von denen Calvin nur zwei anerkennt: die Taufe und das Abendmahl. Als Dreingabe legt Calvin dem Leser ein grosses Argumentarium in die Hand, mit dem er sich gegen andere Glaubensrichtungen erfolgreich zur Wehr setzen kann.
Doch was folgt nun als Substrat aus mehr als 800 Seiten geballtem theologischem Wissen? Es ist eine Erkenntnis, die uralt, aber doch auch immer wieder neu ist: der Mensch kann sich durch eigene Taten nicht selbst erlösen. Nur Gottes Gnade kann ihn erheben und sein Leben erneuern. Wer auf der anderen Seite Gott nichts nachfragt, begeht einen verhängnissvollen Fehler. Und genau das ist es, wovor Calvin die Menschen bewahren will. Sein gerne als unangenehm empfundener Eifer ist aufrichtig und ohne Eigennutz auf das Wohl der Menschen gerichtet. Calvin will seinen Mitmenschen zu einem erfüllten und gelingenden Leben verhelfen. Und er ist bis auf den Grund seines Herzens davon überzeugt, dass dies nur durch eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott möglich ist.
Hinter Calvins Forderungen stehen keine Machtansprüche. Man kann ihm alles mögliche vorwerfen, aber nicht, dass er ein Machtmensch war. Er selbst schrieb seinen Freunden immer wieder, dass er am liebsten das stille und zurückgezogene Leben eines Gelehrten führen würde. In Genf wurde Calvin mit der Aufgabe betraut, den Aufbau der reformierten Kirche zu leiten. Zuerst zögerte Calvin. Doch dann nahm er den Auftrag an und verabschiedete sich vom beschaulichen Gelehrtendasein. Seiner Aufgabe widmete sich Calvin mit allen Kräften. Für halbe Sachen war der kleine Mann mit dem Spitzbart ohnehin nie zu haben. Und Begriffe wie Disziplin, Redlichkeit oder Pflicht waren für ihn genau so wichtig wie sein Missionsauftrag. Doch barg diese Haltung stets auch ein ernstes Konfliktpotential. Und Konflikte waren in Calvins Leben keine Seltenheit. Schliesslich ging es um nichts weniger als um das Seelenheil – und da darf es keine Kompromisse geben. Dies war es, was Calvin antrieb.
Das Vermächtnis des Theologen
Wer Calvin genauer kennenlernen will, muss also die Instutio lesen. In ihr findet sich der direkte Weg, der zum Verständnis dieses genialen, aber auch eigensinnigen Mannes führt. Ursprünglich als Katechismus konzipiert enthielt die Institutio in der letzten Fassung ganze achtzig Kapitel, aufgeteilt in vier Bücher. Nach der Lektüre der einleitenden Kapitel, sollte der Leser zu Beginn des zweiten Kapitels kurz innehalten und tief durchatmen. Denn nun holt Calvin aus zu einem kräftigen Rundumschlag gegen das menschliche Selbstwertgefühl. Duch die Sünde ist der Mensch einem Fluch verfallen, schreibt Calvin. Ihres freien Willens beraubt kommt aus der menschlichen Natur nichts als Verdammliches (II, 3). Das sind harte Worte, die nicht so recht in unsere moderne Zeit passen wollen. Aber es war auch nie Calvins Ziel, den Menschen zu gefallen. Calvin, der Misanthrop? Nein, ganz im Gegenteil. Schon in den nächsten Kapiteln (ab II, 4) erläutert der Theologe den biblischen Plan, der aus der Sackgasse führt. Der Plan kommt von Gott selbst, der die Menschen liebt und ihnen alle Gaben für ein glückliches Leben schenkt. Jesus Christus kam in die Welt um uns von Gottes Wesen und von seinem Plan zu erzählen. Wer auf Jesus vertraut, findet Frieden und darf sich Goittes Verheissung sicher sein.
Das klingt gut. Aber wie finden wir diesen Frieden? Calvin antwortet: dadurch, dass wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und mit seinem Tod für unsere Sünden bezahlt hat. Und dadurch, dass wir uns selbst nicht ganz so wichtig nehmen, dafür etwas mehr auf Gott vertrauen und unseren Mitmenschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Hauptsumme des christlichen Lebens ist gemäss Calvin die Selbstverleugnung. Und damit sind wie wieder bei einem Begriff angelangt, der bei unseren Zeitgenossen nicht gerade Begeisterungsstürme auslöst. Warum sollen wir uns also selbst verleugnen? Im dritten Buch der Institutio (III, 7) steht die Antwort: nur so schaffen wir in uns selbst Platz, der dann von Gott ausgefüllt werden kann. Und da Jesus ein guter Hirte ist, können wir auf diesem Weg nur gewinnen.
Im Kapitel 20 des dritten Buches kommt Calvin auf dann das Gebet zu sprechen. Und dieses soll ein Christ pflegen, so gut er kann. Denn im Gebet kommen wir Gott immer näher. Durch die Bibel spricht Gott zu uns und im Gebet hört er uns zu. Durch das Gebet empfangen wir dann auch die von Gott verheissenen Segnungen. Johannes Calvin legt grössten Wert auf das Gebet, er erläutert bis ins Detail, wie wir beten sollen und was ein Gebet alles enthalten sollte. Gott ist für Calvin ein gütiger Vater, der uns zuhört und an unserem Geschick Anteil nimmt. In jedem Moment unseres Lebens. Calvins Bild von Gott ist von erhabener Grösse. Gott steht weit über allem Irdischen, er ist der Ursprung von allem was ist und er ist auch das Ende, zu dem alles zurückkehrt. Aber zugleich ist uns Gott auch nahe. Er möchte für uns Menschen ein Vater sein. Und ein Freund.
So schreibt auch Calvin am Ende des Vorwortes der Institutio: «Leb wohl, lieber Leser. Wenn Du irgendeine Frucht aus meinen Bemühungen empfängst, hilf mir mit Deinen Gebeten bei Gott, unserem Vater.»
Calvin war ein Schwerarbeiter, sein Arbeitstag dauerte oft 18 Stunden. Aber für etwas hatte er dennoch immer Zeit: für seine Freunde. So wird berichtet, dass er sich von seinem schweren Amt bei Ausflügen am Genfer See mit Freunden erholte. Calvin war kein Tyrann, denn Tyrannen haben keine Freunde. Sein ganzes Werk ist auch eine Einladung zur Freundschaft. Für seine Zeitgenossen – und für uns.


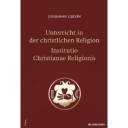
 Die für das 500-Jahr entworfene Webseite über den Genfer Reformator wird unter neuem Namen weitergeführt:
Die für das 500-Jahr entworfene Webseite über den Genfer Reformator wird unter neuem Namen weitergeführt:  Das Thema dieses LTW-Beitrages sind sichere Passwörter. Das mag im ersten Moment wenig aufregend klingen. Wenn man sich aber einen Moment Zeit nimmt und das Thema «chüschtiget», dann könnte sich dieser erste Eindruck rasch in eine andere Richtung wenden. Denn unsichere Passwörter sorgen regelmässig für Schlagzeilen. Nämlich dann, wenn es jemandem gelingt, mit Hilfe von entschlüsselten Passwörtern Zugriff auf fremde Daten zu erhalten. Freilich, meistens ist es nicht das schwache Passwort, das dafür sorgt, dass ungebetene Gäste auf eine Mailbox oder auf ein Twitter Konto zugreifen. Auch eine Schwachstelle im System oder ein simples Postit am Arbeitsplatz können den Zugriff auf die persönlichen Informationen freigeben.
Das Thema dieses LTW-Beitrages sind sichere Passwörter. Das mag im ersten Moment wenig aufregend klingen. Wenn man sich aber einen Moment Zeit nimmt und das Thema «chüschtiget», dann könnte sich dieser erste Eindruck rasch in eine andere Richtung wenden. Denn unsichere Passwörter sorgen regelmässig für Schlagzeilen. Nämlich dann, wenn es jemandem gelingt, mit Hilfe von entschlüsselten Passwörtern Zugriff auf fremde Daten zu erhalten. Freilich, meistens ist es nicht das schwache Passwort, das dafür sorgt, dass ungebetene Gäste auf eine Mailbox oder auf ein Twitter Konto zugreifen. Auch eine Schwachstelle im System oder ein simples Postit am Arbeitsplatz können den Zugriff auf die persönlichen Informationen freigeben. 
