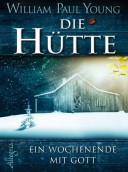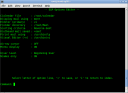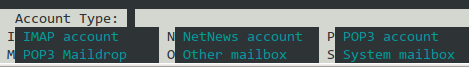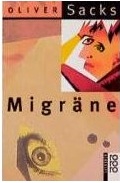Hin und wieder vernachlässige ich meinen Blog; während Tagen, Wochen oder gar Monaten. Der Grund für diese Pausen ist schlicht der, dass es mir an Ideen fehlt. Das Interesse am Bloggen habe ich durchaus nicht verloren. Oder es fehlt mir – wie so vielen Menschen – an Zeit. Und schliesslich gibt es Momente, die ich sehr gerne mit Schreiben ausfüllen würde, allein ich kann gerade dann nicht. Der Grund dafür ist ein Beschwernis, das mich schon seit meiner Kindheit treu begleitet: die Migräne.
Nun ist in Lehrbüchern, Magazinen und in der medizinischen Fachliteratur schon sehr viel über diese Volkskrankheit geschrieben worden. Und daher ist es müssig, dass ich mich als medizinischer Laie auch noch darüber äussere. Dennoch möchte ich auf den folgenden Zeilen den Schmerz kurz skizzieren, so wie er sich bei mir seit 35 Jahren äussert. Und ich möchte davon berichten, wie es mir gelungen ist, mit diesem Schmerz zu leben und die Zahl der Anfälle niedrig zu halten.
Ein Anfall dauert in der Regel zwischen 20 und 25 Stunden, er kann sich ab er auch bis zu 30 Stunden hinziehen oder – leider in seltenen Fällen – kürzer sein. Begleitet wird das Unwetter im Kopf von den bekannten und gut dokumentierten Symptomen: Übelkeit, Schwindel, Lichtempfindlichkeit und ein trockener Gaumen. Die Belastbarkeit des Körpers wie des Geistes ist bei einem schweren Anfall massiv eingeschränkt. Manchmal sind die Symptome so stark, dass die Migräne nur liegend in einem dunklen Raum einigermassen zu ertragen ist. Bei starken Schmerzen ist auch Arbeiten nicht mehr möglich. Einigen Stunden arbeiten kann ich jedoch bei einem weniger intensiven Anfall, wenn auch nur eingeschränkt.
So wie sich ein nahendes Gewitter durch dunkle Wolken am Horizont ankündigt, hat auch die Migräne ihre Vorboten, die auf ein nahendes Blitzen und Donnern im Kopf hinweisen. Benommenheit, leichter Schwindel und innere Unruhe stellen sich ein. Die Nervosität nimmt zu, während die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Bald darauf ist der erste, dumpfe aber noch leichte Schmerz im Kopf spürbar. Er wird stärker und erreicht nach ein bis zwei Stunden das Vollbild der Migräne: ein sehr intensiver, pulsierender und pochender Schmerz, der bis in den Nacken ausstrahlt und den ganzen Körper lähmt. Am stärksten ist der Schmerz direkt hinter den Augen. Nach rund drei bis vier Stunden erfolgt dann eine Verlagerung des jetzt stark hämmernden Schmerzes auf die eine Seite des Schädels, wobei das Zentrum noch immer direkt hinter dem Auge liegt. Von dieser Verlagerung auf eine Kopfseite hat die Migräne ihren Namen: hemi-kranion ist griechisch und heisst übersetzt: halber Schädel. In der nun erreichten Intensität setzt sich der Schmerz für weitere 10 bis 15 Stunden fort, um dann langsam abzuklingen. Anschliessend wird die Migräne abgelöst von einem entspannten Wohlgefühl und von Erleichterung. Manchmal gefolgt von einer ausgeprägten Hochstimmung!
Soweit also der Verlauf der Migräne. Ich sollte vielleicht noch anfügen, dass ich nie Auras oder Sehstörungen habe. Oliver Sacks bezeichnet diese Form der Migräne in seinen ausgezeichneten Buch «Migräne» als einfache Migräne.
Ausgelöst wird eine Migräne durch Stress, Ärger, Überarbeitung, Alkohol oder Lärm. Ebenso durch zu viel Sonnenlicht, unregelmässiges Schlafen und – besonders heimtückisch – durch Entspannen von der Arbeit am Wochenende.
Wie bei so vielen Problemen ist auch bei der Migräne falsche Ernährung ein wichtiger Trigger (Auslöser), dem viel Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte! Was aber heisst das konkret? Es lässt sich zusammenfassen mit einem Rat der sieben Weisen: nichts im Übermass! Das heisst, dass auch die «üblichen Verdächtigen» wie Schokolade, Käse, Fleisch oder scharfe Speisen kein Problem sein müssen, solange sie mit gesundem Mass genossen werden …wenigstens in meinem Fall ist das so! Auf Fleisch verzichte ich wann immer möglich, denn ich fühle mich dadurch wohler und beweglicher. Aber wie steht es mit Alkohol? Er verdient den Titel eines Migräneauslösers ersten Grades! Lediglich beim Essen ein (und wirklich nur ein) Glas Rotwein ist einigermassen gefahrenlos. Möglicherweise wird erst im zweiten Moment deutlich, dass dies eine gute Nachricht ist…
Was Tabak und andere Drogen betrifft, so sind Migräniker (und nicht nur diese) gut beraten, wenn sie ganz verzichten.
Was ist zu tun, wenn eine Migräneattacke sich ankündigt? Am besten rasch eine Pause machen und viel trinken, am besten kühles Wasser oder Cola, vielleicht auch etwas Bohnenkaffee. Wie bei den Auslösern ist die Wirksamkeit dieser Mittel bei jedem Patienten etwas anders. Helfen kann in dieser Phase auch ein Eisbeutel auf dem Kopf (ein nasser Wöschplätz tut’s auch) oder das älteste bekannte Mittel gegen Migräne: Niesspulver!
Nun folgt das wichtigste: wer regelmässig an Migräne leidet, soll ja muss zum Arzt gehen, bevor zu Schmerzmitteln aus der Apotheke gegriffen wird. Falsch angewendet können diese mehr schaden als nützen und in eine Abhängigkeit führen.
Manche Menschen haben Glück und werden im Laufe ihres Lebens ganz von der Migräne geheilt. Bei anderen verändert sich das Migränebild mit den Jahren und wieder anderen gelingt es, durch einen Massnahmenkatalog die Zahl der Anfälle deutlich zu reduzieren. Ich zähle mich (wie vermutlich die meisten «Opfer») zur dritten Gruppe und möchte nun darüber berichten, welche vorbeugenden Mittel mir geholfen haben. Zwei Dingen sind dabei wichtig: zum ersten dürfen sie nicht als allgemein gültige Heilmittel verstanden werden. Mir haben sie geholfen, jemand anders hat damit vielleicht keinen Erfolg oder kann sie gar nicht erst anwenden. Das Erarbeiten eines passenden Massnahmekataloges dauert meist nicht Wochen, sondern Monate oder Jahre. Und zum zweiten: ein einzelnes Wundermittel gegen die Migräne gibt es nicht. Eine erfolgreiche Migränetherapie muss den Menschen als Ganzes im Blickfeld behalten und auf das Wesen, das Gesundheitsbild und auf individuelle Merkmale eingehen. Die Therapie entwickelt dann einen Katalog aus Massnahmen, von denen einige Medikamente zur Prophylaxe sein können.
Ein anderer Teil kann darin bestehen, einige Lebensgewohnheiten anzupassen. Ein Beispiel: Entschleunigung und ewas mehr Gelassenheit im Alltag lösen die Anspannung und mindern das Migränerisiko. Ich weiss, das ist locker dahergesagt, aber in der Praxis schwer durchzuhalten. Es braucht zum Erfolg zweierlei: Üben! Und bei Rückschlägen nicht entmutigen lassen.
Der moderne (!) Mensch neigt dazu, zu wenig zu trinken. Und wer seinen Körper austrocknen lässt, bekommt eher früher als später Kopfweh. Eine weitere Regel zur Eindämmung lautet deshalb: regelmässig Wasser trinken. Noch bevor der Durst sich einstellt. Hier sind einige weitere Massnahmen, die zu meinem Katalog gehören:
Kondition. Ich glaube, dass es einen direkten Kausalzusammenhang zwischen Migräne und körperlicher Fitness gibt. Jedenfalls gelingt es mir, die Anzahl der Attacken (dieser Begriff ist keine Übertreibung) durch regelmässiges Konditionstraining drastisch zu reduzieren. Es braucht dazu keine sportlichen Höchstleistungen. Ein regelmässiges, leichtes Lauftraining genügt schon, wobei die Regelmässigkeit ebenso wichtig ist wie der Sport selbst. Mir hilft ein Lauftraining, das rund 30 Minuten dauert und sich jeden zweiten Tag wiederholt.
Magnesium. Flüssigkeitsmangel als Auslöser wurde schon erwähnt. Nun muss von einem zweiten, nicht minder prominenten Trigger die Rede sein: Magnesium- und Eisenmangel. Diese führen bekannterweise zu Kopfschmerzen und werden in kaum einem Fachbuch zu diesem Thema ausgelassen. So kann ein Magnesiumpräparat aus der Apotheke als erstes Medikament zur Vorbeugung ausprobiert werden. Auch hier gilt: mehrere Wochen testen, frühestens dann kann über die Wirksamkeit eine Aussage gemacht werden.
Regelmässiger Schlaf. Das Schlafverhalten hat auf unsere Gesundheit einen entscheidenden Einfluss. Auch ein erwachsener Mensch braucht sieben bis acht Stunden Schlaf pro Tag. Und wer jeden Tag zur selben Zeit seinen Schlaf geniesst, lebt gesünder. Viele Migräniker haben am Wochenende Probleme, wenn sie in eine Entspannungsphase eintreten, dadurch ein Donnerwetter im Kopf auslösen und dann vom ersehnten Wochenende nicht mehr viel haben… Will ich damit dem Ausschlafen am Wochenende den Abschied geben? Auf keinen Fall! Entspannen und Loslassen vom Arbeitsalltag sind nicht nur sehr wichtig sondern auch schön! Das Problem muss von der anderen Seite, also durch Reduktion der Anspannung gelöst werden. Nur so lässt sich die gefürchtete Wochenendmigräne vermeiden.
Medikamente zur Prophylaxe. Um die Anzahl der Anfälle zusätzlich zu reduzieren, bieten sich Medikamente an, von denen einige Naturheilmittel sind. Etwa die Biodoron Tabletten von Weleda. Oder Pestwurz-Medikamente. Wirken diese nicht, bieten sich Beta-Rezeptorenblocker an. Eingenommen werden dürfen diese Medikamente nur in Begleitung eines Spezialisten.
Was aber, wenn die Migräne trotz allen Vorsichtsmassnahmen sich ankündigt und man sich wirklich elend fühlt? Und wegen der Arbeit vielleicht nicht einfach ausruhen kann? Die wirksamsten Medikamente zur Eindämmung sind Triptane, von denen es verschiedene Hersteller und Zusammensetzungen gibt. So muss der Rat wiederholt werden: zusammen mit dem Arzt das passende Notfallpräparat finden. In meinem Fall hilft der Wirkstoff Zolmitriptan (in der Schweiz also «Zomig» erhältlich) von AstraZeneca. Nach der Einnahme baut sich der Schmerz samt aller Nebensymptome nach 30-60 Minuten komplett ab.
Zum Abschluss möchte ich einige bekannte Vorurteile rund um die Migräne vorstellen:
- Die Migräne ist ein Kopfschmerz. Ja, auch, aber nicht nur. Ein Migräneanfall geht tiefer, er hat Auswirkungen auf den ganzen Körper. Zudem ist eine Migräneattacke wesentlich heftiger und schmerzhafter als etwa ein Spannungskopfschmerz.
- Nur Frauen haben Migräne. Richtig ist, dass Frauen etwa dreimal häufiger an Migräne leiden als Männer. Quelle: Wikipedia.
- Migräne ist nur eine Einbildung. Eine Migräne wird begleitet von sehr realen und auch sichtbaren Symptomen: Übelkeit, Erbrechen, veränderte Gesichtsfarbe, etc. Der Schmerz kann so stark werden, dass er nur noch im Liegen einigermassen erträglich ist. Hildegard von Bingen, die regelmässig an Migräne litt, sagte, dass der Schmerz deshalb einseitig sei, da er sonst nicht mehr auszuhalten wäre.
- Ärzte können auch nicht helfen. Doch, sie können! Gerade in den vergangenen Jahren wurde das medizinische Wissen über die Migräne deutlich erweitert und der Krankheit konnten dadurch einige Geheimnisse entlockt werden. Ärzte nehmen sich für Migränepatienten Zeit und können mit gezielten Therapien helfen, dass die Migräne seltener auftritt oder ganz verschwindet. Passende Medikamente können einen schweren Anfall in weniger als 30 Minuten stoppen.
Mehr Infos zur Migräne: Kopfschmerzen: Ursachen, Arten und natürliche Hausmittel (Primal State)
Nachtrag vom 22. Februar 2021: Oft beginnt eine Migräne Nachts beim Schlafen; mit einem klaren Kopf geht man zu Bett, mit Schmerzen erwacht man in den frühen Morgenstunden! Migräne Patienten berichten, dass Sie um sechs Uhr schmerzfrei sind. Schlafen sie dann noch einmal ein, wachen sie ein bis zwei Stunden später mit Schmerzen wieder auf! Was hier helfen kann: 1. Geregelte Ruhezeit einhalten und nicht am Morgen ausschlafen – ein Schlafbedürfnis kann etwas später nachgeholt werden, zum Beispiel mit einem kurzen Mittagsschlaf (max. 20 Minuten). 2. Manche Patienten berichten, dass ein Bohnenkaffee vor dem Einschlafen hilft, ganz allgemein gilt, dass genügend Flüssigkeit wichtig ist! 3. Schlafzimmer gut lüften. Gerade während der Heizphase im Winter kann die trockene Luft einen Migräneausfall in der Nacht auslösen! 3. Nicht belastet oder mit Angstgefühlen einschlafen; der Schlaf tut gut und schenkt Erholung. Vertrauen Sie darauf, dass Sie am Morgen ausgeruht und mit einem klaren Kopf den neuen Tag begrüssen können.