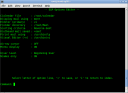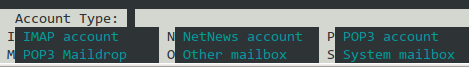Wir können sie heute überall in den Autos antreffen: manchmal sind sie mit einem Saugnapf an der Frontscheibe befestigt, manchmal an einem Lüftungsschlitz eingehängt und – immer öfter – fest im Bordcomputer am Armaturenbrett eingebaut. Gemeint sind natürlich die Navigationsgeräte, oder kurz «Navis», die kleinen Computer also, die dem Fahrer fast auf den Meter genau per Bild und Sprachanweisung den Weg zum Ziel weisen. Als vor rund 10 Jahren die ersten Geräte auf dem Markt zu haben waren, wurden sie als technische Wunderwerke angesehen, teuer und exklusiv. Heute sind sie eine zum Alltag gehörende Selbstverständlichkeit, so wie das Smartphone oder das Notebook.
Was das Navigieren angeht, gab es im letzten Jahrtausend schon einmal eine Entwicklung, welche die damals stark in Entwicklung begriffene Seefahrt revolutionierte. Es war der Kompass, der im Mittelalter aufkam und eine präzisere Navigation auf den Weltmeeren erst möglich machte. In einer wolkenverhangenen Nacht, wenn der Steuermann am Ruder sich nicht nach den Sternen richten konnte, half ihm die in einem kleinen Wasserbecken schwimmende Magnetnadel. Sie wies die Richtung, die das Segelschiff auf seinem Kurz zum Zielhafen ansteuern musste. Der Kompass erwies sich beim Kurshalten als wichtiges und fast immer zuverlässiges Messinstrument. Trotzdem musste der Seemann die Sterne kennen, denn ein guter Seefahrer muss beim Kurshalten alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen können. Beim modernen Navi ist es nicht anders: fällt es aus, ist derjenige im Vorteil, der auch mit Hilfe einer Strassenkarte den Weg findet. Das kleine, aber technisch hoch entwickelte (und gerade deswegen störungsanfällige) Geräte am Armaturenbrett könnte ja ausfallen oder – ganz banal – wegen einer Baustelle vorübergehend nicht mehr nutzbar sein.
Der Kompass oder das Navi weisen uns auf der Fahrt den Weg, heute vielleicht nur zu einer anderen Strasse im Dorf. Morgen möglicherweise zum fernsten Punkt auf dieser Erde. Wir finden den Weg in den Weiten der vier Himmelsrichtungen. Was aber passiert, wenn wir zu den zentralen Fragen des Lebens Orientierung suchen: wer sind wir, woher kommen wir und wohin gehen wir? Zu diesen Fragen kann kein Navigationsgerät eine Antwort geben, die Antwort ist auf der Windrose des Kompass nicht zu finden. Gibt es denn überhaupt ein Navi, das uns zu diesen Fragen den Kurs weisen kann?
Ja, es gibt diese Navigationshilfe. Sie ist im neuen Testament überall zu finden. Etwa beim letzten Abendmahl, so wie es der Evangelist Johannes überliefert: beim Passah in Jerusalem verabschiedete sich Jesus im Bewusstsein seines nahen Todes von seinen Jüngern und wies auf ein künftiges Zusammensein im Himmel hin. Da fragte Thomas ihn nach dem Weg: «wie sollen wir den Weg dorthin kennen?» «Ich bin der Weg», antwortete Jesus dem zweifelnden Thomas. «Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben.» Jesus wies seinen Jüngern den Weg in die ewige Gemeinschaft mit Gott und sie verstanden ihn! Aber wie können wir die Antwort verstehen, nach mehr als 2000 Jahren? Unsere Lebensrealität ist nicht die der römischen Antike auf den grünen Bergen in Galiläa. Wir können die Antwort verstehen. Wir können es, wenn wir das tun, was die Jünger des Zimmermannes auch taten. Sie glaubten an Jesus und an die gute Nachricht, die er in die Welt brachte. Wir finden diese gute Nachricht in den Büchern des neues Testaments. Wenn wir das einzigartige Angebot von Jesus annehmen, dass wird die Bibel zu einer Navigationshilfe, die niemals versagt und uns auch in den grössten Stürmen des Lebens sicher zum Ziel führt.